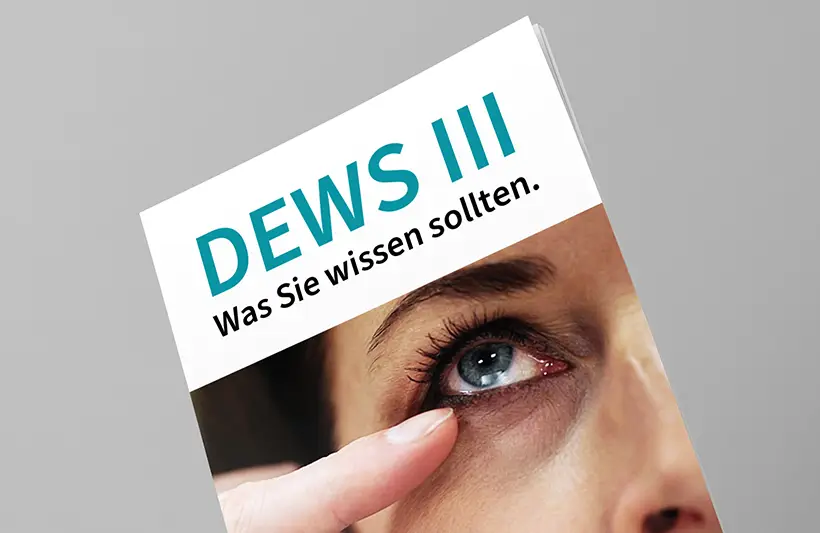
DEWS III auf den Punkt: Was Sie wissen sollten
Lang erwartet: ein Meilenstein in der Augenheilkunde
Im Mai 2025 war es soweit: Die dritte Ausgabe des „Dry Eye Workshop Reports“ (DEWS III) wurde als Vorabdruck im American Journal of Ophthalmology veröffentlicht. Nach DEWS II (2017) durfte man mit Spannung erwarten, welche Neuerungen in der Diagnose und Therapie des Trockenen Auges vorgestellt würden. 80 Experten aus 18 Ländern trafen sich seit Ende 2023, um neue Publikationen zum Thema Trockenes Augen und assoziierte Augenoberflächenerkrankungen zu sichten, zu bewerten und zu diskutieren. Das Ergebnis: eine 3-teilige Publikation mit über 630 Seiten (inklusive Literaturverzeichnis), bestehend aus:
- einer Zusammenfassung („Digest Report“)
- einem Diagnostik- und Methodik-Teil
- einem Abschnitt zum Erkrankungs-Management
Historische Bedeutung von DEWS I & II
DEWS I und vor allem DEWS II waren wegweisend: Zum ersten Mal wurde die verfügbare Evidenz gesichtet, bewertet und in einem internationalen Konsens zusammengefasst. Besonders wichtig war die Definition des Trockenen Auges, die seit 2017 international anerkannt war:
„Das trockene Auge ist eine multifaktorielle Erkrankung der Augenoberfläche, die durch einen Verlust der Homöostase des Tränenfilms gekennzeichnet ist und mit Augensymptomen einhergeht, bei denen Tränenfilminstabilität und Hyperosmolarität, Entzündungen und Schäden der Augenoberfläche sowie neurosensorische Anomalien eine ätiologische Rolle spielen.“
Was gibt es nun Neues im DEWS III Report?
Das ist gar nicht so einfach festzustellen, da, und das wäre mein Hauptkritikpunkt, der Report leider keine durchgängige Abgrenzung Alt-Neu vornimmt. Der Report setzt voraus, dass Expertenwissen auf Basis von 2017 besteht und selbst erkannt wird, in welchen Details neues Wissen geschaffen wurde. Hierbei fehlt mir vor allem, dass die internationalen Experten die Relevanz des Neuen zum Beispiel in pointierten Zusammenfassungen darstellen. Der „Digest Report“ ist irgendwie keine richtige Zusammenfassung des gesamten Reports, sondern beinhaltet die Themen Geschlecht und Hormone, Epidemiologie und Risikofaktoren, Pathophysiologie, Schmerz, iatrogenes Trockenes Auge sowie das Design von Klinischen Studien.
Positiv hervorzuheben sind vor allem:
- die Kapitel zu Schmerzen und neuropathischen Aspekten
- die Bewertung klinischer Studien und therapeutischer Verfahren im Management-Teil
Hier liegt meiner Ansicht nach der größte Mehrwert im Vergleich zu DEWS II.
Stärken und Schwächen des Reports
DEWS III bietet viel Expertenwissen – für Praktiker allerdings zum Teil zu grundlagenorientiert und ohne klare Praxisabgrenzung zu DEWS II.
Bemerkenswert ist die tendenzielle Entwicklung weg von der Entzündung als Kernpathomechanismus, die in einigen Teilen Einzug hält. Auf Basis von Studien, die praktisch ausschließlich Tränenfilmanalysen durchgeführt haben, wird geschlussfolgert, dass nicht alle Formen des Trockenen Auges mit einer Entzündung einhergehen. Dies berücksichtigt leider nicht, dass der Tränenfilm keine vollständige „Kopie“ des Zustands der Augenoberfläche darstellt und dass bislang in jeder experimentellen Studie zum Trockenen Auge ein Gewebeschaden und sei es nur auf zellulärer Ebene festgestellt wurde. Da Gewebeschäden immer mit Entzündungsreaktionen einhergehen, halte ich das Wegbewegen vom Begriff der Entzündung für falsch.
Für die Praxis besonders relevant
Einige Abschnitte sind für die tägliche Arbeit besonders lesenswert:
- Risikofaktoren-Tabelle (Kapitel 6.6, Digest Report)
- Differenzialdiagnosen (Kapitel 3.1, Diagnostik-Methodology)
- Terminologie-Update: Der Begriff „Syndrom“ soll im Zusammenhang mit dem Trockenen Auge nicht mehr verwendet werden.
- Neuro-Komponente: Die Rolle des lokalen und systemischen Nervensystems wird stärker betont. Gleichzeitig erfolgt eine klare Abgrenzung zu neurotropher Keratopathie und neuropathischen Schmerzen – wichtig für klinische Klassifikation und Kommunikation mit Kostenträgern
Auch der diagnostische Algorithmus – Fragebogen, Break-up-Time, Osmolarität, Anfärbung der Augenoberfläche – bleibt nahezu unverändert und kann weiterhin als Minimalstandard gelten.
Die Definition des Trockenen Auges wurde leicht angepasst:
„Das trockene Auge ist eine multifaktorielle, symptomatische Erkrankung, die durch einen Verlust der Homöostase des Tränenfilms und/oder der Augenoberfläche gekennzeichnet ist, wobei Tränenfilminstabilität und Hyperosmolarität, Entzündungen und Schäden der Augenoberfläche sowie neurosensorische Anomalien als ätiologische Faktoren gelten.“
Das Herzstück: Das Krankheitsmanagement
Die eigentliche Stärke von DEWS III liegt meiner Meinung nach im Management-Teil. Hier werden nahezu alle Therapieoptionen – lokal, systemisch, medikamentös, physikalisch – detailliert dargestellt und im Vergleich zu 2017 bewertet.
Besonders lesenswert:
- die Bewertung lichttherapeutischer Verfahren (Evidenz weiterhin als hinterfragenswert bewertet)
- die Einschätzungen zur Wirksamkeit, Nebenwirkungen und praktischen Anwendung bestehender Therapien
Besonders lesenswert:
- Patientengespräche über Wirksamkeit und Risiken
- Entscheidungen zur Sprechstundenstruktur oder eigenen Investitionen
- Diskussionen zur Erstattung durch Krankenkassen
Dabei ist zu beachten, dass viele Verfahren bislang nur in bestimmten Märkten – vor allem in den USA – verfügbar sind.
Fazit: Licht und Schatten
Insgesamt hat der Report demnach meines Erachtens Licht- und Schattenseiten. Natürlich ist ein derartiges Werk immer Spiegel der Zusammensetzung von Experten mit eigenen Erfahrungen, Meinungen und Interessen. Daher kann man den Report in Gänze als ausgewogen bezeichnen, allerdings nicht als weiterer Meilenstein.
Es besteht leider ein (zu) starker Fokus auf den nordamerikanischen Markt. Weiterhin ist der Report für den Nicht-Experten zu lang, zu detailliert und nicht als einfache Lektüre zu empfehlen. Wie dargestellt fehlen in großen Teilen eine praktische Bewertung und Abgrenzung zum Stand des Wissens von DEWS II.
Es ist daher sinnvoll, dass lokale Experten weitere Zusammenfassungen und praktische Bewertungen vornehmen und so, wie schon im DEWS II, eine Relevanz für die Behandler und Patienten im Kontext des lokalen regulatorischen, rechtlichen und marktbezogenen Systems und unter Berücksichtigung der regionalen Kultur entstehen kann.
Ich bin gespannt auf die folgenden Diskussionen in der Fachwelt und Rückmeldung zu eigenen Erfahrungen nach dem Studium von DEWS III.
Ihr,
Prof. Philipp Steven

