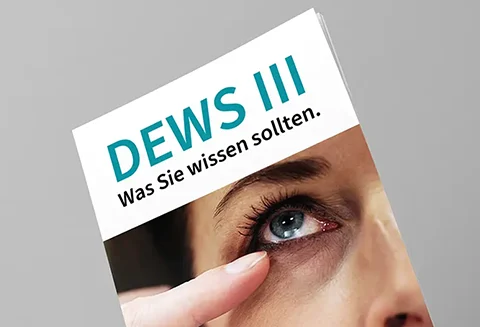Trockene Augen: Wie das Arztgespräch den Therapieerfolg verbessert
Wenn die Standardtherapie nicht mehr hilft
Wir kennen alle die Situation: Eine Patientin beklagt Trockene Augen-Beschwerden, die Therapie würde nicht greifen, ständig seien die Augen gerötet und würden schmerzen, das Sehvermögen würde schwanken, die Lebensqualität sei nicht mehr dieselbe. Die zielgerichtete Untersuchung hat milde Veränderungen ergeben, eine leicht reduzierte Breakup Time, verringertes, trübes Meibomsekret und etwas posteriore Blepharitis und ein geringgradiges Staining der inferioren Hornhaut. Die Anwendung von Tränenersatz, Lidrandpflege und sogar niedrig dosierte Steroide über mehrere Wochen haben keine Besserung gebracht.
Oft entsteht dann der Impuls, ein weiteres Tränenersatzmittel oder nochmal erneut Steroide einzusetzen, vielleicht sogar topisches Cyclosporin für 6 Monate. Und da sind noch die anderen 10 Patienten, die vor dem Untersuchungszimmer auf die Behandlung warten. Da man nur 5 Minuten für Untersuchung und Gespräch hat, muss also eine schnelle Entscheidung getroffen werden und die Patientin geht mit einem Rezept, einem vorgefertigten Merkzettel für eine Lidrandpflege und dem Verweis: „Wir sehen uns in 3 Monaten“ nach Hause.
Doch die Wahrscheinlichkeit, dass diese „neue“ Therapie greift und die Patientin beim nächsten Besuch zufriedener ist, liegt erfahrungsgemäß unter zwei Prozent.
Warum ein ausführliches Gespräch oft entscheidend ist
- Wie genau belasten die Beschwerden den Alltag?
- Was findet gerade im Leben der Patientin statt?
- Lassen sich Rückschlüsse auf Compliance und Therapieadhärenz ziehen?
- Gibt es andere Erkrankungen oder Medikamentenwechsel, eine Wirkung verhindern?
- Und zu guter Letzt, habe ich als Behandler die Patientin als Mensch wahrgenommen?
Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich zentral wichtige Informationen erst nach 5 Minuten ungeteilter Aufmerksamkeit erfahren habe. Die neue Krebserkrankung, der Tod eines Angehörigen oder eines Haustiers. Die schlechte Anwendbarkeit einer Tropfenflasche, ein anstehender Umzug, und so weiter. All dies hat Einfluss nicht nur auf den Organbefund sondern vor allem auf das subjektive Erleben der Erkrankung und auf die Schwere der Symptome.
Psychosomatik oder ärztliche Basisarbeit?
Man kann das als Psychosomatik verstehen und für die Augenheilkunde als nicht relevant erachten. Man kann das aber auch als ärztliche Basistätigkeit verstehen und therapeutisch einsetzen. Das Dilemma hierbei ist die zur Verfügung stehende Zeit und die Frage, wie lange ein wirksames Gespräch sein sollte und welche Inhalte das Gespräch haben sollte. Dies wird leider in der Augenheilkunde nicht spezifisch gelehrt. Weiterhin sind typische Gespräche aus dem Bereich der Psychosomatik nicht so einfach auf die Augenheilkunde übertragbar.
Praktische Tipps für wirksame Arzt-Patienten-Gespräche
Aus meiner eigenen Erfahrung haben sich folgende Punkte bewährt:
- Spezialsprechstunden nutzen: Fokussierte Sprechstunden mit geringerer Taktung erleichtern intensive Gespräche.
- Strukturierte Kurzgespräche führen: Fünf Minuten mit wenigen, aber gezielten Fragen, z.B.:
- Wie geht es Ihnen im Vergleich zum letzten Mal?
- Was gibt es Neues in Ihrem Leben?
- Vertragen Sie die Therapie?
- Was stört Sie am meisten?
- Wann sind die Beschwerden am schlimmsten?
- Gibt es Momente, in denen Sie beschwerdefrei sind?
- Auf Hinweise achten: Konflikte, Sorgen oder Belastungen können Symptome verstärken.
- Mein Tipp: Physisch zuwenden: Sprechen Sie nicht durch die Spaltlampe, wenden Sie sich den Patienten direkt zu.
- Spiegeln: Sie können verbale und nonverbale Reaktionen der Patienten aus ihrer Sicht wiedergeben. Beispiel: Was ich jetzt hier sehe, ist eine Patientin, die aktuell sehr überlastet ist und kaum in der Lage ist den Alltag zu bewältigen. Könnte das sein? Was müsste sich hier ändern?
Zwei Ziele – große Wirkung
Ziel eines solchen Gesprächs sind zwei Dinge:
- Die Patientinnen und Patienten fühlen sich zugewandt und ernst genommen.
- Sie erleben sich selbst als kompetente Gesprächspartner.
Interessanterweise sind diese beiden Ziele hochwirksame therapeutische Mechanismen, die in vielen Fällen eine unmittelbare Verringerung von Symptomen erzeugen. Zusammen mit einer guten Erklärung zu den vorhandenen Organveränderungen, am besten unter Zuhilfenahme von fotografischen Aufnahmen, erhöht dies die Therapieadhärenz und das Therapieansprechen.
Fazit: Fünf Minuten können den Unterschied machen
Fünf Minuten Gespräch können mehr bewirken als die nächste Tropfenverordnung. Sie schaffen Vertrauen, verbessern die Compliance und helfen, Patientinnen und Patienten als Ganzes zu behandeln – nicht nur das Auge.
Ihr,
Prof. Philipp Steven